Steuerliche Maßnahmen kein Thema
Das Heranführen der EnEV an den heutigen Stand der Technik würde sich anbieten, die Verknüpfung von EnEV und EEWärmeG bietet Möglichkeiten, die KfW-Förderung, weitere Unterstützungen auf Landesebene. Es besteht natürlich darüber hinaus prinzipiell die Möglichkeit, steuerliche Förderungen einzuführen – der ehemalige 82a EStDV war damals sehr erfolgreich. Bisher sind steuerliche Maßnahmen aber regelmäßig am Bundesrat gescheitert und es lohnt auch nicht, sie jetzt ins Gespräch zu bringen, weil dann erst recht nichts getan wird und die potentiellen Bauherrn und Modernisierer abwarten, bis denn die steuerliche Förderung kommt – der Begriff „Attentismus“, abwartende Haltung, ist gerade in der Heizungsbranche mittlerweile ein geflügeltes Wort. Deswegen tut man gut daran, im Moment überhaupt nicht darüber zu diskutieren. Ziel muss es sein, dass kontinuierlich investiert wird und kontinuierlich Verbesserungen vorgenommen werden. Das dient der Umwelt, das dient dem Klima, das dient vor allem der lokalen und regionalen Wirtschaft, das reduziert die Importabhängigkeit von Energieexporteuren und hält Wertschöpfung im Lande.
Das Beste ist ein Zuschuss, weil sich das Gros der Gebäudeeigentümer dem Rentenalter nähert und dann von steuerlichen Erleichterungen wenig profitiert. Gewerbliche Investoren können ihre Modernisierung ohnehin geltend machen.
Das mag richtig sein. Wobei man allerdings aufpassen muss. Der Markt, die Anbieter antizipieren sehr schnell die Höhe der Förderung und preisen sie ein. Wir haben das ja aus dem 4,2-Mrd-DM-Fensterprogramm gelernt, das damals Helmut Schmidt gemeinsam mit Giscard d’Estaing beschlossen hat, um die Konjunktur in beiden Ländern anzukurbeln. In Deutschland wurde damals der Fensteraustausch mit 30 Prozent bezuschusst – genau um diesen Prozentsatz stieg kurz nach Verabschiedung des Programms der Fensterpreis, sodass der Topf schneller als vorgesehen leer war. Wir brauchen einfach mehrere Instrumente, um alle Akteure und Zielgruppen anzusprechen. Wir brauchen Kredite, wir brauchen die Investitionszuschüsse, wir brauchen eigentlich auch die steuerlichen Maßnahmen, wir brauchen zusätzliches Ordnungsrecht, das im Augenblick im Wesentlichen nur im Neubau wirksam ist. Es gibt massive Widerstände aus der Immobilienwirtschaft, wenn es um den Bestand geht. Der Bestand unterliegt dem Wirtschaftlichkeitsgebot. Aber wie berechnet man die Wirtschaftlichkeit in Theorie und Praxis? Vordergründig gesehen ist eine der negativen Seiten der Rebound-Effekt: Wenn die „Warmmiete“ sinkt, kann man ja ruhig etwas mehr verbrauchen.
Welche Technologien?
Siehe das Beispiel Norderstedt in den 80er-Jahren. Es waren rund 90 Einfamilienhäuser, die man mit einer modernen Heiztechnik sanierte und zum Vergleich eine bestimmte Anzahl unsaniert ließ. Die sanierten Häuser verbrauchten mehr.
Aber auch solch ein Verhalten schwindet, wenn ich einen längeren Zeitraum zugrunde lege. Spätestens nach zwei oder drei Jahren verliert sich die Erinnerung an die Vorzeit. Dann gelten die aktuellen Preise oder es ziehen neue Mieter ein. Die Sanierung ist ja auf mindestens 20 Jahre angelegt. Der Rebound-Effekt existiert in der ersten Zeit – Mieter und Eigentümer fahren einfach eine um ein oder zwei Grad höhere Raumtemperatur und beheizen selbst ungenutzte Räume, weil es nicht ins Geld geht und weil man ja ein „gutes Gewissen“ hatte – man wohnt ja schließlich in einem energieeffizienten Gebäude. Hier hilft nur Information und Beratung – das Bewusstsein, dass man selbst handeln kann und damit auch seine Energierechnung beeinflussen kann, muss gestärkt werden.
Diskutierten Sie in Paris Technologien?
In Paris existierten zwei Welten. In der einen Welt trafen sich die Verhandler, die Tag und Nacht versuchten, die Notwendigkeiten zur Bekämpfung der globalen Treibhausgaseffekte in völkerrechtlich verbindliche Formulierungen zu bringen. Die zweite Welt spiegelte die Realität. Die zweite Welt artikulierte sich in Veranstaltungen, in denen Länder und Industrien zeigten, welche Entwicklungen genutzt werden könnten, um die Treibhauseffekte zu reduzieren. Dort wurde also über die Technologien gesprochen, unter anderem über GuD-Kraftwerke, Wärmepumpen, über Brennstoffzellen, über Nahwärme-Versorgungssysteme, über Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), über Wärmerückgewinnung, über Fenster, über Wärmedämmung, über Architektur, über Ressourceneffizienz. Wir wissen heute technologisch viel mehr als 1997 in Kyoto. Wir wissen heute konkret, wie wir Emissionen reduzieren können. Es wurde jedoch nichts priorisiert. Die Aufbruchstimmung in die reale Welt machte Paris zu einer Erfolgsstory.
Ausstieg aus den drei Brennstoffen
Wir sprachen nicht nur über die Technik. Wir sprachen über Produktion und Konsum. Ist der tägliche Fleischkonsum unter klimaschutzpolitischen Gesichtspunkten so ohne weiteres zu akzeptieren? Wir sprachen über die Kostendegression bei Erneuerbaren Energien, wir diskutierten die Frage, wie lange fossile Brennstoffe noch genutzt werden können: Kohle, Öl und Gas. Bis Ende dieses Jahrhunderts will man weltweit aus diesen drei Brennstoffen aussteigen. Ich meine jetzt in ihrer fossilen Form, ohne nachgeschaltete Umwelttechniken. Wenn man dagegen den emittierten Kohlenstoff wieder auffängt, beispielsweise über CCS (Carbon Capture and Storage) sammelt und einlagert, spricht zwar immer noch etwas gegen ihren Einsatz, weil die Fossilen für andere Zwecke eher gebraucht werden, etwa in der Chemie oder in der Pharmazie, aber man kann durch CCS unter Umständen sogar zu negativen Emissionen kommen. Das vom Biogas emittierte CO2 fängt man auf, bringt es unter die Erde. In Deutschland ist aber diese Technologie mittlerweile verpönt. Derzeit wird über CCU geforscht, „U“ für „Utilization“, für die Wiederverwendung des CO2: Wie kann man also aus CO2 neue Produkte entwickeln, wie Treibstoffe oder Kohlenstoff als Rohstoff nutzen – CCU als Chance, Kohlenstoff zumindest partiell im Kreislauf zu führen.
Sie nannten die Brennstoffzelle – Deutschland hat für die Brennstoffzelle ein spezielles Programm eingeführt. Der scheint man mithin einen bestimmten Stellenwert in der zukünftigen Wärme- und Stromversorgung zu geben, obwohl sie auf der Wärmeseite nicht besser als ein Gas-Brennwertkessel ist und auf der Stromseite bei dem Überfluss an PV- und Windstrom ebenfalls mit den beiden nicht konkurrieren kann.
Heizen mit Strom
Ich sehe die Brennstoffzelle zukünftig weniger in Einzelgebäuden. Ich sehe sie vielmehr eher in der Nahwärmeversorgung. In diese Richtung werden wir in der Versorgung gehen: Wohnareale oder Quartiere mit einer größeren Brennstoffzelle oder mit einer Groß-Wärmepumpe beziehungsweise Gas-Wärmepumpe auszurüsten und dann an ein Nahwärmesystem anzuschließen. Da macht es Sinn. In Einzelgebäuden werden wir etwas bekommen, was früher die Kollegen aus dem Bundesumweltamt unter die Decke gebracht hätte, das Heizen mit Strom. Die kostbare Exergie „Strom“ sei viel zu wertvoll, um sie für niederenergetische Zwecke einzusetzen, etwa für eine Zimmertemperatur um 20 °C. Doch dürfte es von der Kostenseite her kaum zu vertreten sein, wenn wir für den dann deutlich verringerten Wärmebedarf – bis 2050 soll der Primärenergieverbrauch des gesamten Gebäudebestands schließlich um 80 Prozent reduziert werden – eine Gasleitung in die zukünftigen Niedertemperaturhäuser, die ab 2021 zu realisieren sind, hineinlegen oder einen Öltank aufstellen, der eine aufwendige Logistik nach sich zieht.

Für solche Objekte erprobt ein vom Umweltministerium gefördertes Projekt im Moment eine neue Technologie. Die könnte ebenfalls im Altbau die Nachtspeicheröfen ohne einen größeren Aufwand ersetzen. Die neue Technik besteht aus einem Heizgeflecht an der Wand oder an der Decke, das im Prinzip wie eine Tapete einfach nur aufgeklebt wird. Elektrische Strahlungsheizungen sind flink. Sie bringen sofort die notwendige Wärme. Sie erlauben darüber hinaus, Räume unterschiedlich auszustatten und nur die Aufenthaltsbereiche zu beheizen.
Aus heutiger Sicht plädiere ich generell dafür, technologieoffen vorzugehen. Wir wissen heute alle noch nicht, wie die Zukunft genau aussehen wird. Zu vieles ist ungewiss – Energiepreise, technologische Entwicklung, Infrastruktur, Sektorkopplung.
Besser an der Wand als in der Wand
Nun sind ja elektrische Strahlungsheizungen nichts Neues. Elektrisch beheizte Fußböden waren schon vor der Warmwasserheizung da.
Die reagieren aber nicht so flink. Die liegen zentimetertief im Boden oder in der Wand und müssen den Estrich oder den Belag zunächst einmal temperieren. Das müssen die heizenden Oberflächen-Geflechte nicht. Das Spannende an ihnen ist, dass man sie ausschalten kann, wenn man den Raum verlässt und wieder anschaltet, wenn man den Raum betritt. Man heizt nicht kontinuierlich, sondern nach Bedarf. Und man kann abschnittsweise heizen, also nur die Sitzecke oder den Besprechungstisch in einem Besprechungszimmer. Auch darin liegen die erheblichen Einsparungen. Die sollen deshalb 30 bis 40 Prozent betragen. In Berlin-Spandau läuft gerade ein Versuch unter Beteiligung einer Immobiliengesellschaft. Diese Technik wäre natürlich auch etwas für die 5 Mio. Nachtspeicherheizungen, die wir noch heute in Deutschland haben und die sich auf dieses Verfahren umrüsten ließen. Alte Nachtspeicher müssten dann nicht mehr mit einem Ventilator Staub- und Asbestwolken in die Zimmer pusten.
Sie haben vorhin die Gas-Wärmepumpe genannt. Über die Elektro-Wärmepumpe bekäme man den Überfluss an Wind- und PV-Strom besser weg.
Power to Gas
Den können Sie auch anderweitig unterbringen, etwa über Speicher, Power to Heat, Power to Gas – das wäre dann auch etwas für die Gas-Wärmepumpe –, Power to Liquid. Die Umwandlung der Elektrizität in Gas hat den Vorteil, über einen größeren Zeitraum Erzeugung von Verbrauch entkoppeln zu können. Für den Physiker wegen der damit verbundenen Verluste ein Graus – für den Ökonomen sinnvoll, der hier die Chance sieht, nicht benötigten Strom sinnvoll zu nutzen, anstatt für abgeregelten Windstrom auch noch EEG-Zulage zu zahlen.
Ja, der Warmwasser-Pufferspeicher an der elektrischen Wärmepumpe kann nur für ein paar Stunden verschieben. Herr Schafhausen, die Welt und Europa haben über den Emissionshandel den Schadstoffausstoß aus Großanlagen weitestgehend im Griff. Jedes Jahr schrumpft um einen bestimmten Prozentsatz das Volumen der herausgegebenen Zertifikate – und das ist zunächst einmal das Entscheidende. Dass es Ausnahmen und Irritationen gibt, gilt für jede Regelung, gilt für jedes Gesetz. Im Prinzip, so hört und liest man in seriösen Untersuchungen, funktioniert der Emissionshandel, auch wenn er angesichts der niedrigen Preise zurzeit nicht die richtigen Signale ausstrahlt, um Klimaschutz zu bewirken. Die Investitionen in Effizienzmaßnahmen sind teurer als die entsprechende Anzahl an CO2-Zertifikaten. Aber wie gesagt, der Handel erfasst ohnehin nur Großanlagen und damit grob gesehen nur die Hälfte der Emittenten.
Der Emissionshandel hat sich als ein erfolgreiches Instrument zur Schadstoffminderung erwiesen, nur strahlt die europäische Variante gegenwärtig tatsächlich nicht die richtigen Signale aus. Der Markt funktioniert perfekt: Wir haben eine Überliquidität auf dem Markt – konsequenterweise ist der Preis im Keller. Wir diskutieren im Moment sowohl in Berlin wie in Brüssel die Fortschreibung für die 4. Handelsperiode von 2021 bis 2030: Was muss getan werden, um den Europäischen Emissionshandel wieder zu reaktivieren? Es würde jetzt zu weit gehen, wenn ich dies im Einzelnen erläutern würde, obschon es mich in den Fingern juckt. Diskutiert werden auch jene Bereiche, die der Emissionshandel nicht erfasst, nämlich in erster Linie Verkehr und private Haushalte, die Landwirtschaft, wie auch die kleinen und mittleren Unternehmen, also KMU. Die Kommission hat Ende Juli d. J. einen Vorschlag für das sogenannte „Effort Sharing“, für die nicht vom Handel betroffenen Emissionen, vorgelegt.
Heizungen im „Effort Sharing“
Zu diesem Thema hat vor ein oder zwei Jahren das Umweltbundesamt einen Bericht „Ausweitung des Emissionshandels auf Kleinemittenten im Gebäude- und Verkehrssektor“ herausgegeben. Verschiedene Institute haben untersucht, inwieweit bisher nicht erfasste Treibhausgasemissionen, unter anderem die aus den Haushalten, in Deutschland in das Emissionshandelssystem der EU einbezogen werden können. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Einführung juristisch möglich ist und administrativ mit überschaubarem Aufwand umsetzbar wäre. Doch sieht sie im Moment dafür keinen eindeutigen Mehrwert. Die Betonung liegt auf „im Moment“, denn die Studienbearbeiter sagen das Gleiche wie Sie, dass es nämlich auf Dauer nicht haltbar ist, die einzelnen Sektoren getrennt zu betrachten. Es sei langfristig die Einführung geboten, nämlich mit Blick auf die zunehmende Interaktion zwischen den Sektoren.
Das EU-Konzept „Effort Sharing Decision“ (ESD) für die verbliebenen 27 Mitgliedstaaten soll ins Detail gehen, Benchmarks finden und mit harten Zahlen an die Reduktion herangehen. In Paris haben wir zunächst Kriterien beschlossen, wie die Leistungen der einzelnen Staaten in Bezug auf das Effort Sharing aufzuteilen sind. Für uns in Deutschland geht es aber nicht nur um den Klimaschutz. Wir müssen auch aus ganz anderen Gründen die Effizienz erhöhen. Das Thema sprachen wir ja vorhin schon an: 70 Prozent der Energie, die wir hier verbrauchen, kommt aus dem Ausland. Sollten wir nicht die Gelder in eine leistungsfähige Infrastruktur und in Energieeffizienz investieren, um die Wertschöpfung, die wir in Deutschland erzeugen, im Lande zu halten und nicht nach außen abführen zu müssen? Das ist ein genauso entscheidender Punkt wie der Klimaschutz und die Versorgungssicherheit. Ferner hat die Energieeffizienz die Funktion als Treiber für zukünftige gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen. Darüber hinaus bedeutet Ressourcenschutz Sicherung von Substanzen für die nachfolgenden Generationen. Wir können doch nicht ungehemmt in den Boden greifen und den späteren Generationen die Probleme der Bedarfsdeckung überlassen. Wir müssen zukünftig drei Milliarden Menschen mehr ernähren, das heißt, wir müssen unsere heutigen Produktions- und Konsummuster weltweit verändern. Wir müssen bei dem 2-Grad-Ziel wirklich nicht immer nur über Emissionen reden. Vielleicht haben die anderen Punkte einen noch höheren Stellenwert. Die in New York im September verabschiedeten Sustainable Development Goals (SDGs) richten sich auch auf den Klimaschutz und die Energie, gehen aber weit darüber hinaus.
Verheiratung EnEV mit EEWärmeG geplant
Teilweise erarbeiten unterschiedliche Ministerien die Gesetze, obwohl ja Sigmar Gabriel nun die „Energie“ mit hinüber ins Wirtschaftsministerium genommen hat und damit schon EEWärmeG und EnEG in einer Hand liegen. Ganz davon abgesehen fällt es aber schwer, bei diesen vielen Gesetzen im Energiebereich – nämlich Energieeinsparungsgesetz EnEG, Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG, dann das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz EEWärmeG, das Energiewirtschaftsgesetz EnWG und direkt tangierend auch das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz KWKG – den Überblick zu behalten. Nicht ganz verständlich ist auch, warum beim Energieeinsparungsgesetz, und damit bei der Energieeinsparverordnung (EnEV), die Zustimmung des Bundesrats eingeholt werden muss, während das EEG nicht der Zustimmung des Bundesrats bedarf. Die Meinung der Länder spielt hier keine Rolle, obwohl das Bauordnungsrecht wieder Ländersache ist.
Im NAPE, dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz, ist vorgesehen, das EEWärmeG mit der EnEV abzugleichen. Ferner ist generell beabsichtigt, das EEWärmeG und die EnEV zusammenzulegen, das heißt, die Pflicht, Erneuerbare Energien einzusetzen, wird man in die EnEV integrieren. Das wird derzeit überprüft. Darüber hinaus ist es völlig richtig, was Sie sagen – es sind einfach viel zu viele Gesetze und Verordnungen zu ein und dem gleichen Thema zu berücksichtigen. Zumindest dem Praktiker fehlt mittlerweile der Überblick. Es wird aber außerordentlich schwierig sein, dies wieder zu ändern. Man muss aufpassen, um die Planwirtschaft nicht zu weit zu treiben.

Verheiratung EEWärmeG mit der EnEV – bedeutet das, dass das Energierecht andere Schwerpunkte setzen wird?
Erhöhte Technologieneutralität
Das heißt es nicht. Es wird zu einer Verheiratung des EEWärmeG mit der EnEV kommen, aber nach dem gegenwärtigen Stand nicht zu sehr großen Veränderungen. Was im Augenblick diskutiert wird, ist etwa die Frage der Technologieneutralität. Die ist im EEWärmeG nicht durchgängig gegeben. Bestimmte Technologien sind von der Förderung ausgeschlossen. Wer etwa Biogas in einem Brennwertkessel verbrennt, wird nicht gefördert, weil damals die Haltung galt, Biogas sei einfach zu wertvoll, um es in einem Brennwertkessel zu verbrennen. Zuschüsse erhielt oder erhält nur der Einsatz in BHKW. Diese Unterscheidung überzeugt nicht. Wenn sich Biogas ökonomisch in Brennwertanlagen einsetzen lässt, substituiert es fossile Brennstoffe und reduziert damit die CO2-Emission. Von der Seite her ist es dann auch ganz automatisch ökologisch. Warum also Biogas nicht in einem effizienten Brennwertkessel einsetzen?
Stichwort „Des Guten zu viel“: Mittlerweile kritisieren die Verbraucherverbände ja auch die Skalierung der Energielabels. Wer sich heute einen neuen Wärmeerzeuger anschafft, glaubt, mit der Klasse A das Beste zu haben. Tatsächlich ist das Beste ein A mit drei Pluszeichen. Kaum ein Hersteller produziert noch etwas mit der Effizienz B, C oder D. Aber welcher Verbraucher weiß schon, dass er mit einem einfachen A quasi das Schlechteste hat.
Neues Labelling
Die EU hat das bereits erkannt. Sie hat die Novellierung der EU-Energiekennzeichnungsrichtlinie vorgeschlagen. Mit einer einheitlichen A-G-Skala und einer digitalen Produktdatenbank sollen die Angaben zur Energieeffizienz bestimmter Produkte übersichtlicher dargestellt werden. Die Plus-Klassen sollen wegen Irreführung der Verbraucher abgeschafft werden. In Deutschland könnte eine Energielabel-Verordnung ab Mitte 2017 wirksam werden – so sieht es der aktuelle Zeitplan vor.

Vita und Zukunft
Franzjosef Schafhausen, Jahrgang 1948, befasste sich gleich nach seinem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der Universität zu Köln in den Jahren 1978 bis 1986 mit Umweltfragen: Sowohl als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut der Universität Köln und später als Referent im Umweltbundesamt sowie im Bundesinnenministerium. 1986 wechselte er in das nach Tschernobyl eingerichtete Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Die Grünen-Bewegung tat ihr Übriges dazu. Die Gesellschaft diskutierte ökologische Fragen und die tradierten politischen Parteien konnten es sich nicht erlauben, dieses Feld den Grünen zu überlassen. Franzjosef Schafhausen arbeitete unter neun Ministern und Ministerinnen: angefangen bei Friedrich Zimmermann, Klaus Töpfer, nach Walter Wallmann der zweite deutsche Umweltminister, über Angela Merkel, Jürgen Trittin, Sigmar Gabriel, Norbert Röttgen, Peter Altmaier bis zu heute Barbara Hendricks. 2006 übertrug man ihm die Leitung der Unterabteilung „Klimaschutz, Umwelt und Energie“, 2011 die Unterabteilung „Energiewende“.
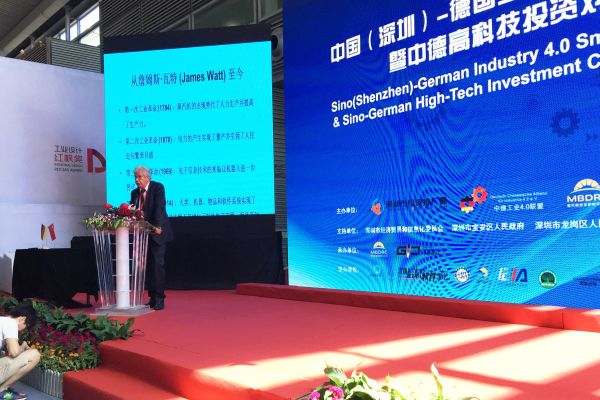
Er saß im JISC des UN-Klimasekretariats, leitete seit 2000 die Interministerielle Arbeitsgruppe „Emissionshandel zur Bekämpfung des Treibhauseffekts“, führt den Vorsitz im Kuratorium „Zukunft des Kohlenstoffmarktes“ und übernahm 2014 als Ministerialdirektor die Leitung der Abteilung „Klimaschutz, Europa und Internationales“, eine der neun Abteilungen, in die das Bundesumweltministerium untergliedert ist. So viel Beziehung, Kompetenz und Know-how sollten eigentlich nicht verloren gehen. Es stellt sich also die Frage:
Herr Schafhausen, treten Sie in den Ruhestand oder in den Unruhestand?
Ich liebe den Begriff „Unruhestand“ nicht. Ich trete aus dem aktiven Bundesdienst aus, fühle mich aber dem Thema weiter verbunden. Deshalb bin ich bereits im Bereich Klimaschutz, Energiepolitik, Energiewende als selbständiger beratender Volks- und Betriebswirt (so § 18 Einkommensteuergesetz) auf nationaler wie auf internationaler Ebene tätig. Interessant finde ich darüber hinaus die Arbeit mit jungen Leuten, die ich im Rahmen eines Lehrauftrags der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer seit dem Sommersemester 2016 wahrnehme und im Rahmen eines zweiten Lehrauftrags am Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln ab Wintersemester 2016/2017. Es gibt noch zahlreiche andere interessante Zusammenarbeiten mit wissenschaftlichen Einrichtungen, aber auch mit der Wirtschaft.
Sie werden eine Brücke bauen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Politik?
Das ist das Ziel. Um Erfolge im internationalen Energiemarkt – der Wärmemarkt ist darin eingeschlossen – zu erreichen, muss man die gesamte Klaviatur spielen können. Es genügt nicht die Technik alleine. Um zu überzeugen, muss man sowohl die Mentalitäten als auch die landesspezifischen Verhältnisse kennen.
Ein Beispiel: Ich komme gerade aus Mexiko. Die Mexikaner gehen völlig anders auf ein Thema ein als etwa die Asiaten. Die Mexikaner diskutieren gerne. Bei den Asiaten dagegen folgen nach einem Vortrag maximal zwei oder drei Fragen von Zuhörern, die sich vorbereitet haben. Es fehlt da das breite Engagement. Aber man muss nicht gleich bis Asien gehen. In Deutschland ist ebenfalls etwas nicht völlig selbstverständlich, was in Mexiko gang und gäbe ist: dass nämlich die unterschiedlichen Ministerien ernsthaft zusammenarbeiten.
Siehe aktuell das Türkei-Papier mit der brisanten Einschätzung des Innenministeriums zur Türkei und Terrorgruppen, an der das Auswärtige Amt und damit das Außenministerium nicht beteiligt waren – angeblich eine Panne im Innenministerium. Aber zurück zur Frage: Wie stellen Sie sich außerhalb des universitären Bereichs Ihre Zukunft vor?
Ich stehe mit vielen Akteuren in Kontakt und bin, wie gesagt, beratend tätig – nutze also meine in 34 Jahren Bundesdienst gewonnenen vielfältigen Erfahrungen. Mein Ein-Mann-Büro habe ich genannt „Energie – Umwelt – Klima (E U K consulting)“ mit Sitz in Berlin und Neuss.








 Frage zum Artikel
Frage zum Artikel

